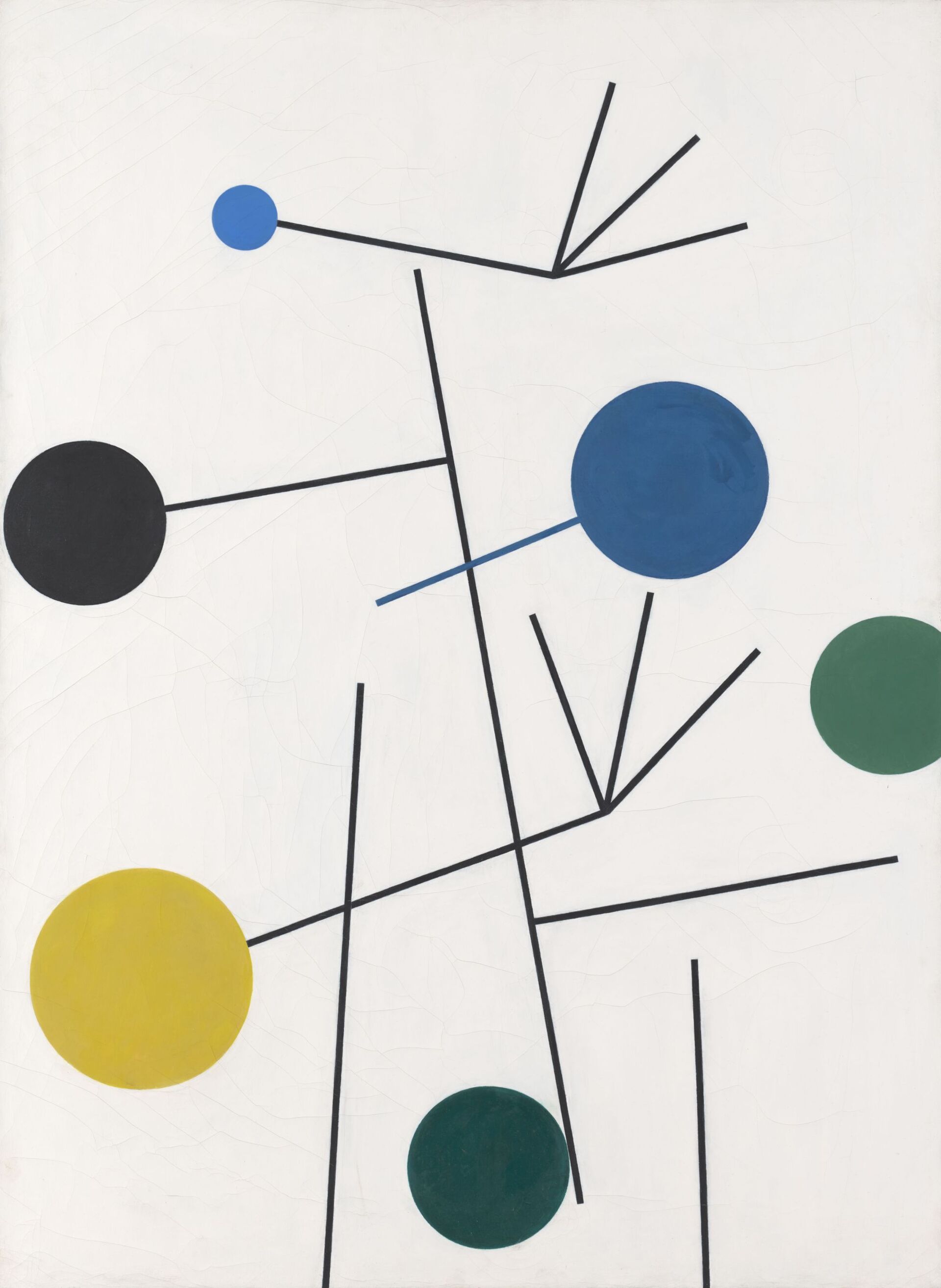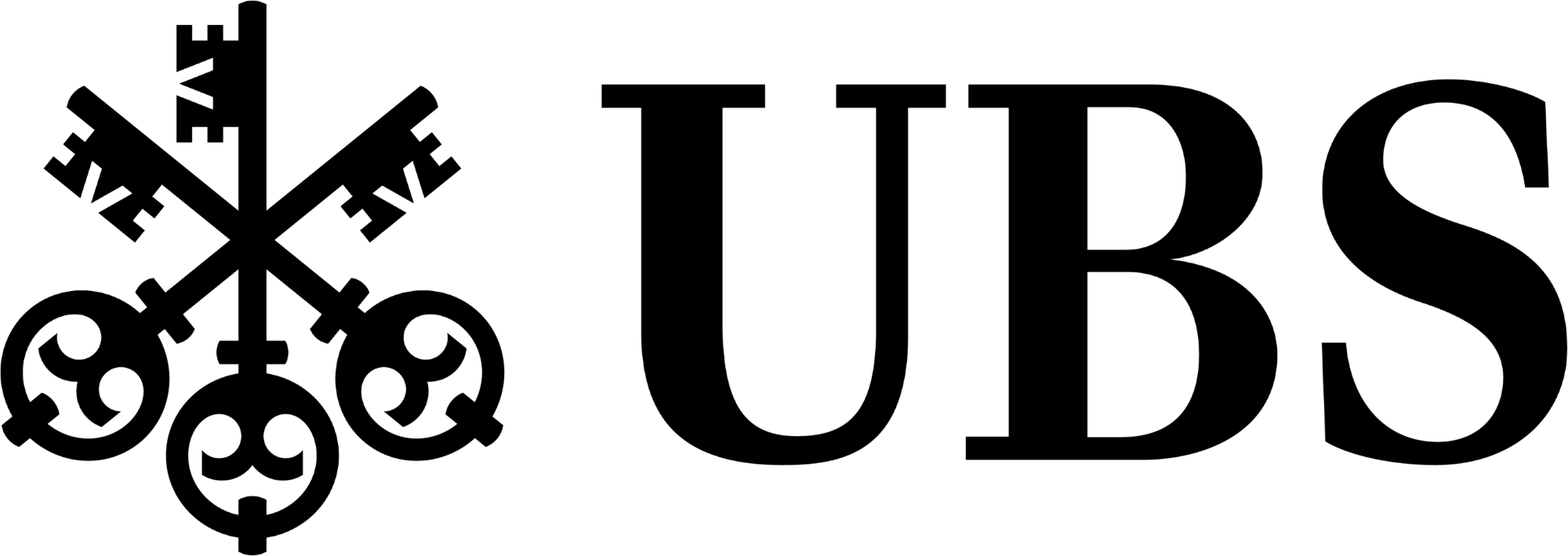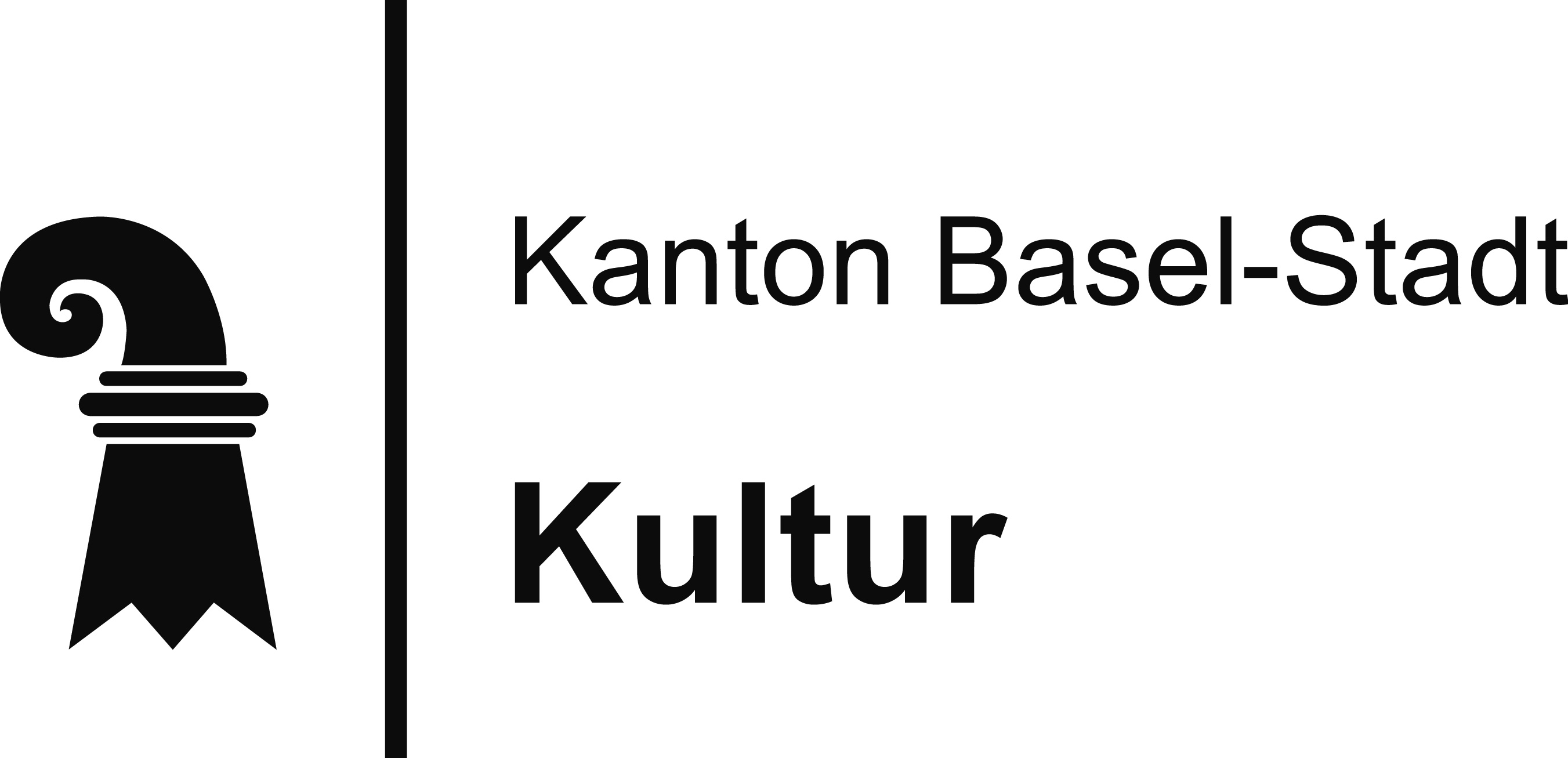Klassische Moderne
Sammlungspräsentation
Im 2. Obergeschoss des Hauptbaus sind die Werke der klassischen Moderne zu sehen, darunter weltberühmte Gemälde wie die Windsbraut von Oskar Kokoschka und Franz Marcs Tierschicksale. Der Rundgang beginnt mit Werken der Fauves und des Kubismus und führt über den Expressionismus und Surrealismus bis zur konstruktivistischen Formensprache. Im Steinsaal, einem der schönsten Räume des Museums, wird das Lebenswerk des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti nachvollziehbar.
Insgesamt 15 neue Werke bereichern seit Juli 2020 die Sammlung: Die farbintensive französische Kunst des frühen 20. Jahrhunderts ist nun durch bedeutende Dauerleihgaben mit Gemälden u.a. von André Derain und Maurice de Vlaminck verstärkt vertreten. Zwei Räume zu Paul Klee und Pablo Picasso sind der Schenkung der Christoph Merian Stiftung aus dem Legat von Frank und Alma Probst-Lauber gewidmet. Und von Gabriele Münter sind gleich zwei Neuerwerbungen zu sehen: ein Gemälde aus der frühen Murnauer Zeit und ein Hinterglasbild als Ankauf der Stiftung im Obersteg. Dank einer Schenkung ergänzt zudem ein Werk von Verena Loewensberg den Konstruktivisten-Saal am Ende des Rundgangs.
Räume
Mit Werken von:
Josef Albers
Hans Arp
Ernst Barlach
Max Beckmann
Max Bill
Georges Braque
Serge Brignoni
Miriam Cahn
Alexander Calder
Marc Chagall
Eduardo Chillida
Giorgio de Chirico
Lovis Corinth
Salvador Dalí
Robert Delaunay
André Derain
Otto Dix
Theo van Doesburg
Jean Dubuffet
Raul Dufy
Helmuth Viking Eggeling
Max Ernst
Lyonel Feininger
Otto Freundlich
Johann Heinrich Füssli
Alberto Giacometti
Fritz Glarner
Julio González
Camille Louis Graeser
Ferdinand Hodler
Alexej von Jawlensky
Wassily Kandinsky
Ernst Ludwig Kirchner
Paul Klee
Lenz Klotz
Oskar Kokoschka
Maria Lassnig
Henri Laurens
Fernand Léger
Wilhelm Lehmbruck
Jaques Lipchitz
El Lissitzky
Richard Paul Lohse
Verena Löwensberg
Aristide Maillol
Franz Marc
André Masson
Henri Matisse
Joan Miró
Paula Modersohn-Becker
Amedeo Modigliani
László Moholy-Nagy
Louis Moilliet
Piet Mondrian
Kiki Montparnasse (Alice Ernestine Prin)
Edvard Munch
Gabriele Münter
Emil Nolde
Meret Oppenheim
Constant Permeke
Antoine Pevsner
Francis Picabia
Pablo Picasso
Germaine Richier
Jean-Paul Riopelle
Dieter Roth
Henri Rousseau (Le Douanier)
Luigi Russolo
Egon Schiele
Oskar Schlemmer
Georg Scholz
Georg Schrimpf
Kurt Seeligmann
Gustaaf de Smet
Jesús Rafael Soto
Niklaus Stoecklin
Sophie Taeuber-Arp
Yves Tanguy
Jean Tinguely
Suzanne Valadon
Kees van Dongen
Georges Vantongerloo
Paule Vézelay
Maria Helena Vieira da Silva
Maurice de Vlaminck
Friedrich Vordemberge-Gildewart
Fritz Winter
Serge Poliakoff
Adya van Rees