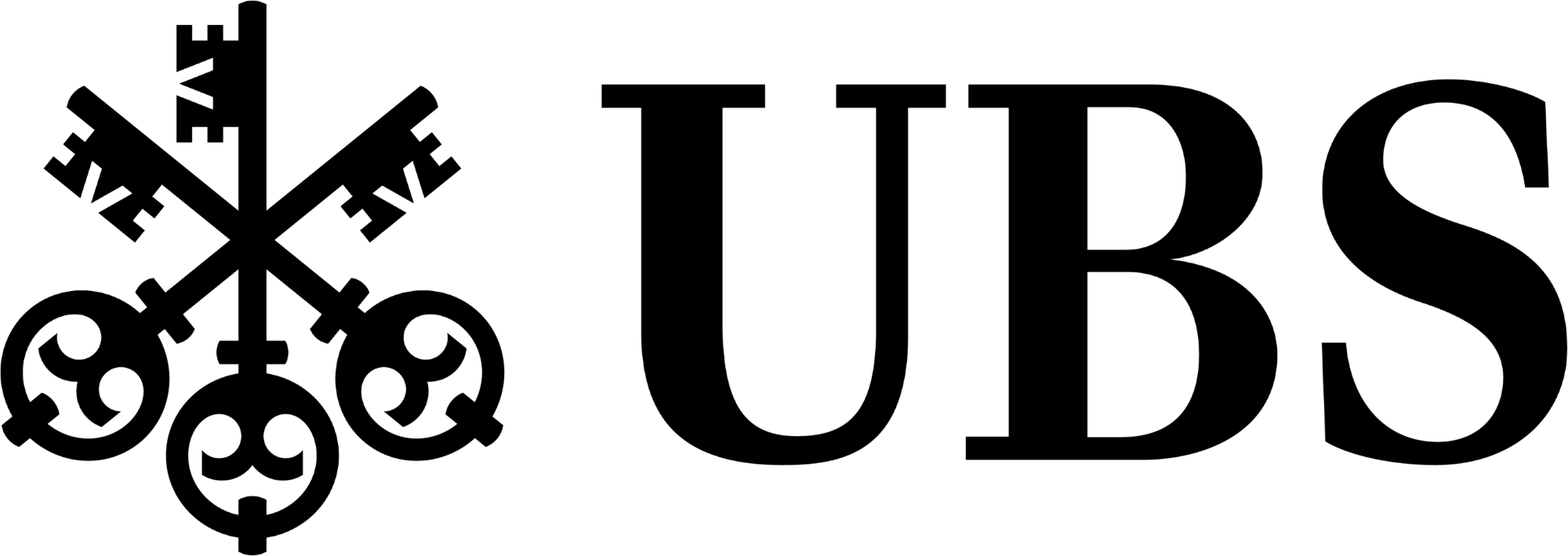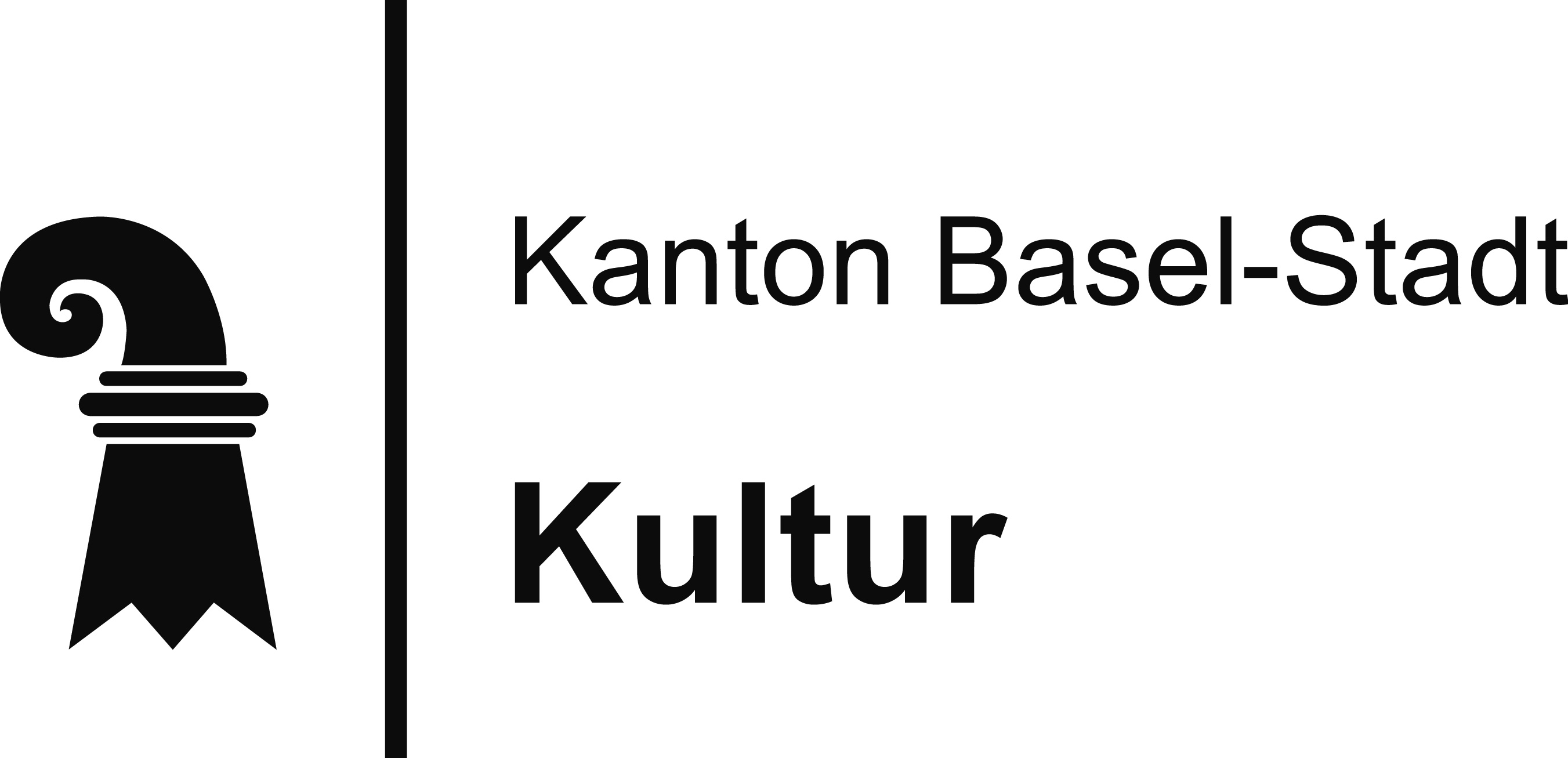Arnold Böcklin (1827–1901) ist neben Hans Holbein d. J. einer der Hausheiligen des Kunstmuseums, das mit über 90 Gemälden und plastischen Arbeiten die bedeutendste Sammlung seiner Werke beherbergt. Der in Basel geborene Künstler erlangte Ende des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum enorme Bekanntheit und zählt zu den wichtigsten Vertretern des Symbolismus.
Schon zu Lebzeiten war Böcklin umstritten. Für die einen war er ein Erneuerer, andere (wie der einflussreiche Kunstkritiker Julius Meier-Graefe) bezichtigten ihn, den Fortschritt in der Kunst aufgehalten zu haben.
In zwölf Konstellationen, in denen Böcklin Werken von Vorläufern, Zeitgenossen und unvermuteten Geistesverwandten begegnet, kristallisieren sich zentrale biografische, stilistische und thematische Aspekte seines Schaffens heraus. Das Stimmungsbarometer schwankt zwischen Satire, atmosphärischer Schwermut und feierlichem Ernst.
Wo Böcklin nicht zu fassen bleibt, wo sich Aufbruchswille und Festhalten an Traditionen in seinem Werk unversöhnlich gegenüberstehen, offenbart er sich als Kind der an Widersprüchen reichen Zeit des Fin de Siècle.
Selbstdarstellung und Aussensicht
(Arnold Böcklin, Selbstbildnis im Atelier, 1893, und Adolf von Hildebrand, Bildnis des Malers Arnold Böcklin, 1898)
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Böcklin in den deutschsprachigen Ländern ein gefeierter Maler, was sich auch in diesen beiden Bildnissen der 90er Jahre spiegelt. In seinem für das Basler Kunstmuseum gemalten Selbstporträt zeigt sich der 66-jährige Maler modisch, selbstbewusst und umgeben von Zeichen seines Wohlstands – von dem gerade überstandenen Schlaganfall keine Spur. Als Adolf von Hildebrand wenige Jahre später im Auftrag der Berliner Nationalgalerie die Büste Böcklins in Bronze ausführt, kommt hingegen eine andere Seite seines langjährigen Künstlerfreundes zum Vorschein.
Zwar war die Fotografie längst erfunden, in der Malerei kann die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung jedoch besonders deutlich hervortreten: Der hyper-reflexiven Selbstdarstellung des Künstlerfürsten, der sich beim Malen des eigenen Bildnisses als Herr über sein Image erweist, steht Hildebrands eindringliche Schilderung eines nachdenklichen, von Alter gezeichneten Mannes gegenüber. Wenn die elementarste Funktion des Porträts in der Vergegenwärtigung des Abwesenden liegt, stellt sich hier die Frage: Wer war Böcklin, und wenn ja, wie viele?
Neuer Blick auf alte Mythen I
(Jean-François de Troy, Diana und Aktäon, 1734, und Arnold Böcklin, Die Jagd der Diana, 1862)
Der römische Dichter Ovid hat mit seinen Metamorphosen eines der populärsten mythologischen Werke überhaupt geschaffen. Seine Verwandlungserzählungen haben zahllosen Künstlern über Jahrhunderte hinweg einen reichen Fundus an Bildideen geliefert. In der Geschichte von Diana und Aktäon wird ein junger Jäger für seinen verbotenen Blick auf die badende Göttin furchtbar bestraft: Er wird in einen Hirsch verwandelt und von den eigenen Hunden zerfleischt. Zwischen den Werken, die Jean François de Troy und Böcklin von unterschiedlichen Szenen dieser Erzählung malen, liegen knapp 130 Jahre, aber auch Welten.
De Troy nimmt das Bad der Göttin zum Anlass, mit leuchtenden Farben und klaren Linien nackte, oder bloss mit leichten Tüchern bekleidete Nymphen zu einer üppigen, galanten Szene zu arrangieren. Der Hirsch wird dabei buchstäblich zur Randfigur.
Auch Böcklin lässt die eigentliche Handlung in den Hintergrund treten. Die Hauptrolle spielt hier das panoramaartige Dickicht, vor dem drei Figuren dem Hirsch hinterherjagen, der bereits den Hunden zum Opfer fällt. Der unkonventionelle Umgang Böcklins mit den hehren Themen klassischer Bildung, wie er sich schon in diesem frühen Hauptwerk zeigt, wurde von den Zeitgenossen als modern empfunden – und stiess nicht immer auf Begeisterung.
Neuer Blick auf alte Mythen II
(Frank Buchser, Odysseus und Kalypso, 1872, und Arnold Böcklin, Odysseus und Kalypso, 1882)
In Homers Odyssee wird die Geschichte von Odysseus erzählt, der aufgrund eines Sturmes auf der Insel der Nymphe Kalypso strandet. Diese nimmt ihn bei sich auf und lockt ihn mit dem Versprechen der Unsterblichkeit. Odysseus erwidert ihre Liebe jedoch nicht und ersehnt die Rückkehr zu seiner Frau Penelope. Sieben Jahre behält Kalypso ihn bei sich, ehe Zeus seine Freilassung befiehlt.
Frank Buchser und Böcklin widmen sich beide im Abstand von zehn Jahren dieser zeitlosen Geschichte einer verschmähten Liebe. Buchser vermittelt ein Gefühl der Dramatik durch Lichtstimmung und malerischen Ausdruck. In der geradezu expressiv wirkenden rechten Bildhälfte lösen sich die Formen zu Farbfeldern auf. Die Sehnsucht Odysseus’ und die Verzweiflung Kalypsos nimmt in den überspannten Körperposen allerdings formelhafte Züge an.
Wo Buchser das Liebesdrama durch den sich abwendenden Amor illustriert, drückt Böcklin Einsamkeit und seelischen Schmerz allein durch die formale und farbliche Isolation der Figuren aus. Statuarisch in sich gekehrt und in kühles Blau gehüllt, wendet sich sein Odysseus von der lasziven und auf flammendes Rot gebetteten Nymphe ab. Die intensive Leuchtkraft der punktuell eingesetzten Farben, die von Zeitgenossen als «schreiend» und «laut» empfunden wurden, zählt zu den zukunftsweisenden Elementen in Böcklins Malerei.
Die Böcklin-Burkhardt-Connection
(Artur Joseph Wilhelm Volkmann, Bildnis von Professor Jacob Burckhardt, 1899, und Arnold Böcklin, Entwurf zur sechsten Maske an der Gartenfassade der Kunsthalle Basel, 1871)
Böcklin schäumte. Einmal mehr hatte die Basler Kunstkommission seine Entwürfe für die Fresken im Museum an der Augustinergasse kritisiert. Sogar sein langjähriger Freund Jacob Burckhardt, der 1853 noch als Trauzeuge die Ehe mit Angela Pascucci testiert hatte und inzwischen zum berühmten Kunstgeschichtsprofessor aufgestiegen war, hatte ihm geraten, die Fresken im Berri-Bau abzuändern. Böcklin vollendet 1870 die Wandmalereien nach seinen Ideen und freskiert überdies zwei Medaillons mit Gesichtern der «verbissenen» und der «dummen Kritik». Doch seine Wut war damit nicht verraucht, sondern wandelte sich in beissenden Spott. Als der Künstler im Folgejahr seine sechs Sandsteinmasken für die Gartenfassade der Kunsthalle Basel präsentiert, sind darin unschwer die karikierten Gesichter der Kunstkommissionsmitglieder auszumachen. Burckhardt selbst erscheint als «naserümpfender Kritiker» mit grotesk verzogenem Gesicht und fliehender Stirn. Der grosse Renaissanceforscher, der eine prägende Rolle für Böcklins Antikenrezeption gespielt hatte, wird nun in diesem völlig unklassischen Maskaron in der Fasnachtsstadt Basel verewigt.
Viel besser gefallen hätte Burckhardt sicherlich das Porträt Artur Volkmanns von 1899. Dem Typus der Frührenaissancebüste folgend, wirkt der Kopf cäsarisch, der Talar wie ein antiker Umhang. Vielleicht hätte der Dargestellte indes selbst bemerkt, dass dieser fast manierierte Klassizismus eine ganz eigene latente Ironie in sich birgt. Doch Burckhardt war bereits zwei Jahre zuvor verstorben.
Gemalte Literatur
(Joseph Anton Koch, Macbeth und die Hexen, 1829/1830, und Arnold Böcklin, Petrarca an der Quelle von Vaucluse, 1867)
Schon seit der Antike standen Literatur und Malerei in enger Beziehung. Im 19. Jahrhundert erfreuen sich literarische Werke neuerer Autoren grosser Beliebtheit in der Kunst und treten als Quelle für Bildideen neben die traditionellen Themen der Mythologie.
Der in Rom tätige österreichische Künstler Joseph Anton Koch malt eine Szene aus Macbeth von Shakespeare, dessen Stücke sich seit dem 18. Jahrhundert auch im deutschsprachigen Raum verbreitet hatten.
In Böcklins Bildnis Petrarcas verbinden sich Literatur und Literaturgeschichte, denn die Lebensbeschreibung des Renaissance-Dichters trägt Züge einer Legende. Böcklin zeigt den grossen Autor im wahrsten Sinne an der Quelle seiner Inspiration: Hier, an der fontaine de Vaucluse, stimmt Petrarca den berühmten Gesang auf seine geliebte Laura an: «Klare und kühle Flut, worin die schönen Glieder sie tauchte, der sich ganz mein Leben weiht».
Ganz im Einklang mit der Naturauffassung der Romantik ist die Landschaft für beide Künstler ein Resonanzraum des Bildgeschehens: wild und aufgewühlt im Moment der schicksalhaften Begegnung des Feldherrn Macbeth mit den Wetterhexen; schützend, träumerisch und keimend, wo sie den Rückzug von der Welt und die kreative Suche Petrarcas symbolisiert.
Kinderbilder
(Anselm Feuerbach, Am Strande, Fischermädchen in Antium, 1870, und Hans von Marées, Das Kind, 1870, und Arnold Böcklin, Vita somnium breve [Das Leben ein kurzer Traum], 1888)
Böcklin, Hans von Marées und Anselm Feuerbach gehören, eine Generation nach Joseph Anton Koch, zum Kreis der sogenannten Deutschrömer – Künstler und Literaten aus den deutschsprachigen Ländern, die ihr Kunstideal durch intensive Studien der Antike und Renaissance in Rom verfolgten. Alle drei widmen sich hier in unterschiedlichem Zusammenhang der Darstellung von Kleinkindern.
Auf einer Leinwand von imposanter Grösse setzt Feuerbach in klassizistischer Manier eine der Zeit enthobene, ideale Mutter-Kind-Beziehung ins Bild, die sich in ihrem feierlichen Ernst kaum von seinen mythologischen Szenen unterscheidet. Bei Böcklin steht das Bild des Kindes für den Beginn des Lebens. Mit seiner Variation des populären Motivs einer Lebenstreppe, das seit dem 16. Jahrhundert den menschlichen Lebensweg durch auf- und absteigende Stufen symbolisiert, schuf Böcklin eine eigensinnige Vergänglichkeitsallegorie. Marées’ Kinderdarstellung hingegen ist weder idealisiert noch symbolisch verstanden. In beinahe erwachsen anmutender Haltung blickt das Kleinkind, das von Figuren und Pferden überragt auf dem Boden sitzt, aus dem Bild heraus. Die auffallend skizzenhafte Malweise verleiht dem grossformatigen Gemälde einen unfertigen Charakter – ein Sinnbild für das Heranwachsen des Menschen?
Symbolistische Spukgestalten
(Arnold Böcklin, Die Pest, 1898, und Albert Welti, Nebelreiter, 1896)
Albert Welti ist, wie Böcklin, das fantasiereiche Erfinden wichtiger als das beobachtende Wiedergeben. Zwischen 1888 und 1891 arbeitete der 35 Jahre jüngere Maler als Schüler in Böcklins Zürcher Atelier. 1895 zog er nach München, bemüht, den Einfluss seines Lehrers hinter sich zu lassen. «Nach zwei Jahren empfand ich die Sehnsucht sehr stark wieder, ohne die Einrede irgend eines, und selbst dieses grossen Geistes einmal aus mir heraus etwas zu unternehmen und auch zu Ende zu bringen», schrieb Welti rückblickend. Wie nahe seine Kunst derjenigen Böcklins vorerst blieb, zeigt sich an seiner symbolistischen Ausgestaltung eines Wetterphänomens: Im wilden Luftkampf toben die Nebelreiter in fahlem Licht um einen verhangenen Berggipfel.
Wie Welti das Wirbeln des Nebels, so personifiziert Böcklin die Pest, die zum Zeitpunkt der Entstehung des Werks in Indien wütete. Die auf einem Drachen reitende alptraumhafte Gestalt des schwarzen Todes, die durch die Gassen einer Stadt fegt, geht auf Entwürfe von 1876 zum Thema der Cholera zurück. Böcklins Beschäftigung mit gefürchteten Krankheiten, Tod und Vergänglichkeit dürfte zumindest teilweise biografische Wurzeln haben: Typhus und Cholera hatten sein eigenes Leben mehrfach bedroht und seine kinderreiche Familie heimgesucht.
Seelenlandschaften
(Arnold Böcklin, Die Toteninsel (Erste Fassung), 1880, und Max Ernst, La grande forêt, 1927)
Die fast schwärmerische Verehrung, die Böcklins Kunst in den deutschsprachigen Ländern um die Jahrhundertwende zuteilwurde, beruhte wesentlich auf der Popularität seines berühmtesten Motivs, der Toteninsel. Diese Ikone des Symbolismus traf den Nerv der Zeit und war als druckgraphische Reproduktion in den bürgerlichen Wohnzimmern des Fin de Siècle anzutreffen.
In dieser Begegnung zweier bildgewaltiger Visionäre scheint sich Max Ernst eine surrealistische Umdeutung der Toteninsel vorgenommen zu haben. Er isoliert seine Komposition inselhaft vom Bildrand und lässt hohe, schlanke Bäume in den dunklen Himmel aufragen. Das riesige, ringförmige Gestirn, das hinter Ernsts grossem Wald aufgeht und ein fahles Licht auf die Landschaft wirft, verrätselt den Bildsinn ähnlich effektiv wie Böcklins irrlichternde Akzente: eine weiss gewandete Rückenfigur und ein verhüllter Sarg auf einem Nachen.
Diese Orte einer Schwellenerfahrung – düster, geheimnisumwoben, jenseitig – zeugen zugleich von der Strahlkraft, die Böcklins enigmatische Seelenlandschaften auf die nachfolgenden Generationen surrealistischer Künstler ausübten.
Ross und Reiter
(Arnold Böcklin, Der Kampf auf der Brücke, 1889, und Edgar Degas, Jockey blessé, um 1896/98)
Ross und Reiter sind in der Kunstgeschichte seit der Antike präsent. Einzeln oder im Verbund, vom Reiterstandbild bis hin zum Motiv wütender Heere, erscheinen Tier und Mensch in machtvoller Symbiose. Ein Beispiel solch durchschlagender Kraft ist Böcklins kriegerische Szene eines Brückenkampfs, für die er sich von der Amazonenschlacht von Peter Paul Rubens (Alte Pinakothek, München) inspirieren liess. Nackt und wild galoppiert eine bestialische Meute von links heran – ein Ansturm, gegen den die zivilisierte Streitmacht zur Rechten hilflos ist.
Degas’ Sturz des Jockeys zieht seine verstörende Kraft auch aus der gewaltsamen Auflösung dieser traditionellen Einheit von Ross und Reiter. Derart tiefe Stürze haben ihr Vorbild in Darstellungen des biblischen Damaskusgeschehens, als die Begegnung mit Gott Saulus auf dem Weg nach Damaskus vom Pferd riss. Degas’ durch und durch weltlicher Sturz jedoch kennt weder Bekehrung noch Neuanfang; sein Held ist ein Gefallener, ein Sinnbild des Scheiterns. Die Entstehungsgeschichte des Gemäldes steht in merkwürdigem Resonanzverhältnis mit seinem Bildthema. Der Künstler hatte mit dem Motiv des vom Pferd gestürzten Jockeys über 30 Jahre hinweg auf einer Leinwand gerungen (National Gallery of Art, Washington), bevor er im hiesigen Gemälde einen Neuanfang unternahm.
Wasserspiele
(Arnold Böcklin, Das Spiel der Nereïden, 1886, und Félix Valloton, Drei Frauen und ein kleines Mädchen im Wasser spielend, 1907)
Was bei Böcklins Meeresnymphen ein einziges Geplansche, Jauchzen und ein ausgelassener Spass in der tosenden Brandung ist (Saltos inklusive), wirkt bei Vallotton distanziert, nüchtern und wie in der Zeit erstarrt.
Beide Maler spielen mit dem traditionsreichen Thema der weiblichen Badenden. Böcklin bedient sich Ende des 19. Jahrhunderts noch, wie so viele Künstler vor ihm (vgl. Jean-François de Troys Diana und Aktäon), des Deckmantels der Mythologie. Allerdings wendet er, sehr zum Unmut vieler Zeitgenossen, die noble Überlieferung ins Groteske. Drall, übermütig und laut lassen seine Nymphen den Betrachter eher schmunzeln, als dass sie voyeuristische Impulse wecken. Wie verstörend Böcklins komische und ironisierende Seite auf die Kritiker wirkte, zeigt sich auch daran, dass dieser Teil seines Œuvres gerne zugunsten der pathosreichen, melancholischen Gemälde ignoriert wurde.
Vallotton präsentierte seine Frauenakte in schiefergrauem Gewässer 1907 im Salon des indépendants in Paris unter dem Titel Baigneuses. Die plastischen Körper, fern jeder Idealisierung oder Mythologisierung, wirken mehr in Licht als in Wasser getaucht.
Langer Schatten
(Arnold Böcklin, Die Lebensinsel, 1888, und Walter Kurt Wiemken, Das Leben, 1935)
Um aus Böcklins langem Schatten herauszutreten, suchten viele Basler Maler die Auseinandersetzung mit dem grossen Vorgänger, was sich mal als Quelle der Inspiration, mal als nahezu lähmende Last erwies.
Wiemkens Gemälde Das Leben, das in seiner surrealistischen Werkphase Mitte der 30er Jahre entstand, zeigt im Titel und im Motiv des bunten Figurenreigens Parallelen zu Böcklins Lebensinsel. Statt freundlicher Frühlingswolken und arkadischer Landschaft aber trägt Wiemkens Welt den Tod im Herzen. Im Leib der Sphinx, dem mysteriösen Zentrum seines Gemäldes, platziert er ein Bildzitat von Böcklins berühmter Toteninsel. Von hier aus hält ein Knochenmann mit Seilen zwei Figuren in seiner Gewalt.
Das böse Omen findet seinen Widerhall in den rätselhaften Szenen einer Hinrichtung und einer Beerdigung. Im Bild der Weltkugel, die kurz vor dem Absturz auf dem Gerüst einer Achterbahn ruht, evoziert der Künstler eine Welt am Abgrund. Wiemken verdichtet hier seine quälenden Kriegsängste, wenngleich unklar bleibt, ob das Motiv der Flaggen eine konkrete politische Bedeutung trägt. Im obersten Register der streng horizontal organisierten Bildebenen – auf einer Art konstruktivistischen Wolke – lenken zwei körperlose Hände mit Fäden das Weltgeschehen geradewegs in den Untergang.
Landschaften des Geistigen
(Arnold Böcklin, Der heilige Hain, 1882, und Cy Twombly, Study for Presence of a Myth, 1959)
Böcklin und Cy Twombly als Seelenverwandte? Zumindest was ihre Eigenart angeht, neben Bezügen zu konkreten Themen der Mythologie auch künstlerische Destillate der antiken Überlieferung zu schaffen: Orte der Erhabenheit, Gefilde stiller Grösse, Landschaften des Geistigen. Dass beide Künstler ihr Arkadien ausserhalb ihrer jeweiligen Heimat fanden und bis zu ihrem Tod in Italien lebten, unterstreicht die Bedeutung der mediterranen Kultur für ihre Kunst.
Böcklin arbeitet für die Sakrallandschaft seines Heiligen Hains mit symbolistischen Mitteln: Das Opferfeuer und die Prozession priesterlicher Gestalten kennzeichnen einen kultischen Ort. Zwischen den Bäumen scheint eine klassische Tempelarchitektur auf, die das Heiligtum als einer antiken Hochkultur zugehörig ausweist. Die weiss gewandeten Figuren verdichten zeichenhaft die feierliche Atmosphäre des Bildes.
Auch Twomblys abstrakter, weisser Bildraum ist mit Zeichen übersät, die geistige Bereiche ebenso wie ein kulturelles Gedächtnis aufrufen – ob durch Zahlenreihen oder durch schriftliche Verweise auf Delos, die ägäische Insel, die als Geburtsort von Apollon und Artemis eine bedeutende Stätte der Verehrung beider Gottheiten war. Twomblys charakteristische Kritzeleien setzen die Spannung zwischen Schrift und Bild fort und gelten als unkonkrete Spuren kolletiver Kulturleistungen.
So weit die Welten Böcklins und Twomblys künstlerisch auch auseinanderliegen, sie wählen hier keine erzählerischen Mittel, sondern formen aus Versatzstücken ewige Augenblicke.
Impressum
Die Texte für diese Sammlungspräsentation entstanden unter Mitarbeit von Studierenden der Arbeitsgruppe «Blickweitungen», geleitet von Dr. Markus Rath, Kunsthistorisches Seminar der Universität Basel: Magali Berberat, Flavia Domenighetti, Elena Eichenberger, Lisa Gianotti, Duco Hordijk, Angela Oliveri, Gabriele Pohlig, Juri Schmidhauser, Zoe Schwizer, Katharina Stavnicuk, Mirjam Strasser, Benno Weissenberger.
Redaktion: Claudia Blank, Dr. Eva Reifert; Kuratorin: Dr. Eva Reifert; Assistenzkuratorin: Claudia Blank