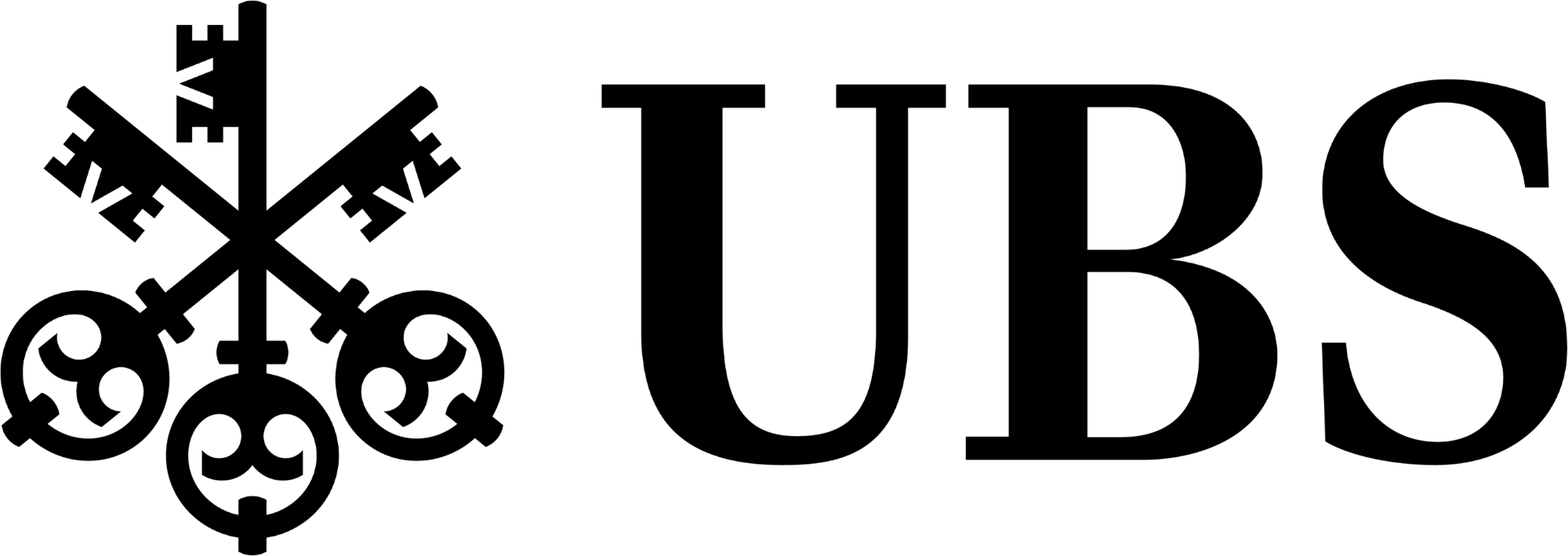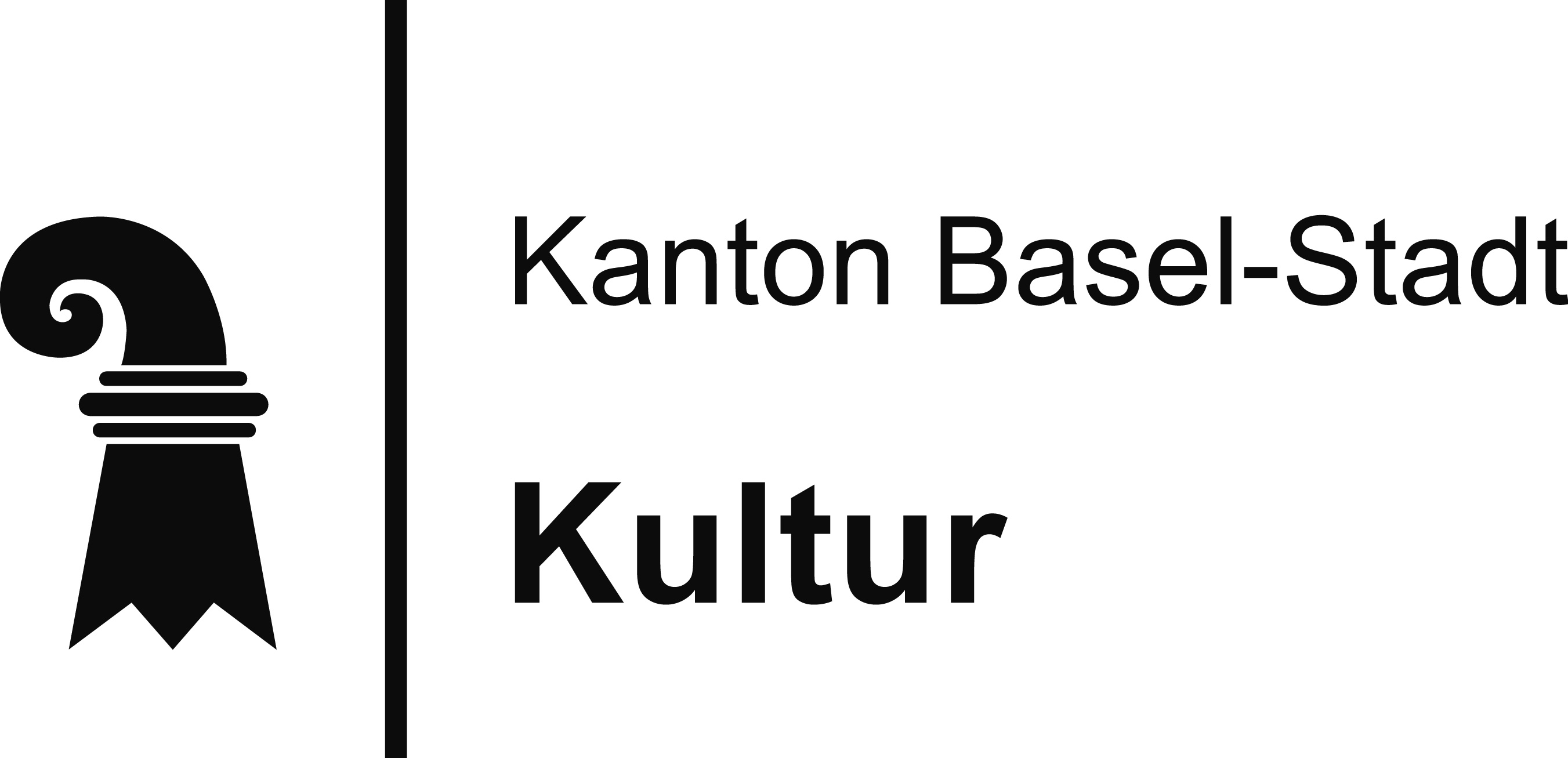Julius Bissier
Zeichnungen und Monotypien
Julius Bissier wurde am 3. Dezember 1893 in Freiburg im Breisgau geboren. Ähnlich wie Paul Klee war er in seiner Jugend noch unentschieden, ob er Musiker oder Maler werden wollte.
Als Zeichner und Maler entwickelte sich Bissier im Wesentlichen autodidaktisch. Während einer ersten Phase von 1915 bis 1923 war seine Kunst geprägt von symbolistisch-expressiven Urzeitlandschaften, in denen er den göttlichen Schöpfungsakt, Katastrophen, Visionen und Heilige darstellte. In dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit der Lektüre der Philosophen und Mystiker Meister Eckhart (um 1260–1328) und Jakob Böhme (1575–1624) und interessierte sich für altdeutsche Malerei, besonders von Matthias Grünewald (um 1475/80–1528) und der Donauschule.
Nach der ersten Galerieausstellung, die 1923 bei Ludwig Schames in Frankfurt am Main stattfand, geriet Bissier in eine schwere künstlerische Krise. Ein Kritiker hatte nicht nur seine Affinität zur altdeutschen Kunst, sondern auch zu derjenigen Chinas bemerkt. Tatsächlich hatte Bissier 1919 den Sinologen Ernst Grosse (1862–1927) kennengelernt, der ihm seither ostasiatisches Gedankengut näher brachte und ihm anhand seiner eigenen Sammlung die Begegnung mit japanischer und chinesischer Kunst ermöglichte. Trotzdem warf die Aussage des Kritikers Bissier aus der Bahn. In der Folge orientierte er sich neu und begann 1924 mit einer der Neuen Sachlichkeit nahe liegenden Malerei, die u.a. inspiriert war von Vincent Van Gogh, Henri Rousseau und der Pittura Metafisica. Es dominierten Stillleben, Landschaften und vor allem Porträts. Neben der Malerei entstanden kleine Tuschezeichnungen, und er beteiligte sich rege an Ausstellungen.
1929 löste ein Besuch in Berlin eine weitere krisenhafte Selbstbefragung aus. Erst die Begegnung mit Willi Baumeister (1889–1955), der ihn ermutigte, ungegenständlich zu malen, eröffnete ihm einen ganz neuen Weg. Er konzentrierte sich fortan darauf, eine Synthese von Abstraktion und Spiritualität in seinen Zeichnungen und Gemälden zu verwirklichen. Bissier fühlte sich ein Jahr später durch das Zusammentreffen mit Constantin Brancusi (1876–1957) in Paris bestätigt, denn in ihm sah er ein Vorbild, was die Vereinigung von Abstraktion und Gehalt betrifft. Erste abstrakte Tuschezeichnungen entstanden Anfang der 30er Jahre.
„Der Weg nach innen“ – Werke ab 1935
Die aktuelle Kabinettpräsentation im Kunstmuseum Basel setzt mit Zeichnungen von 1935 ein, als eine schwere Zeit für Bissier begann. Sein siebenjähriger Sohn starb in diesem Jahr, kurz nachdem Bissiers Atelier mit all seinen Werken niedergebrannt war. Zudem stieg der Druck des nationalsozialistischen Regimes auf Künstler, die sich der Moderne verschrieben hatten, stetig. Es begann eine Phase der inneren Emigration, während der die Freundschaft zu Oskar Schlemmer (1888–1943) eine grosse Bedeutung erhielt, denn nur mit ihm konnte er sich in dieser Zeit über künstlerische Anliegen austauschen.
Von 1932 bis 1947 schuf Bissier fast ausschliesslich Tuschezeichnungen mit dem Pinsel. Auf Reisen nach Italien in den Jahren 1935 und 1937 entstanden knappe Aufzeichnungen von Landschaften. In der Regel zeichnete er aber nun an einem kleinen Tisch zu Hause, denn er hatte 1935 nicht nur sein Atelier, sondern auch den Lehrauftrag an der Freiburger Universität verloren. Um 1936 entstanden neben Stillleben alltäglicher Gegenstände auch surrealistisch anmutende Kompositionen von geheimnisvollen Formen, beispielsweise Korallen, die wie Mahnmale mitten in einer leeren Landschaft stehen. Doch bald wurden sie abgelöst von abstrakteren und symbolhaften Zeichnungen mit Darstellungen von männlich-weiblichen Einheitszeichen, gefässartigen Kapseln und einem Nest im Dornbusch.
Die Beschäftigung mit der Mythenforschung des Baslers Johann Jakob Bachofen (1815–1887) regten Bissier zum Experiment mit der elementaren Symbolik von universellen Gegensätzen an, beispielsweise jener von Leben und Tod, von Mann und Frau, von Schutz und Bedrohung. Gleichzeitig befasste sich Bissier mit chinesischer Kalligraphie und der Lehre der Zen-Maler, die er nicht als Gegensatz oder Alternative zur europäischen Tradition betrachtete. Vielmehr suchte er das festzuhalten, was der europäisch geprägten Mystik und der japanischen Zen-Philosophie gemeinsam war. So übte er sich etwa, in der Manier des „geizigen Pinsels“ zu zeichnen und reduzierte die Bewegung der Hand auf minimale Gesten. Der Künstler wollte seine Tuschezeichnungen allerdings nicht als chinesisch verstanden wissen, und so entfernte er sich im Verlaufe der Zeit von den an asiatische Kalligraphie erinnernden Gebilden und bewegte den mit Tusche getränkten Pinsel zunehmend freier über das Papier.
Immer wieder durchbrach er auch die strenge Reduktion der Tuschezeichnungen auf den Gegensatz von Schwarz und Weiss. Von 1947 bis 1954 entstanden Monotypien*) und anschliessend während zwei Jahren sogenannte „Miniaturen“ in Tempera sowie Aquarelle. Als christlich geprägter Künstler konnte er der Sinnlichkeit der Farbe nicht auf Dauer widerstehen. In diesen farbigen Werken nahm Bissier neben den früher in den Tuschen entwickelten Zeichen (z. B. für Männlich/Weiblich oder Tod/Geburt) auch konkretere Symbole auf wie Pfeile, Kreise, Quadrate, Muscheln, Früchte und Samen.
1939 liess sich Bissier in Hagnau am Bodensee nieder. 1961 zog er nach Ascona, wo er vier Jahre später verstorben ist. Das Kupferstichkabinett Basel konnte 1982 eine grosszügige Schenkung von Lisbeth Bissier, der Witwe des Künstlers, aus dem Nachlass entgegennehmen. Sie beinhaltete Zeichnungen, Monotypien und nahezu das gesamte druckgraphische Werk.
(*) Monotypie: Statt auf Papier zeichnet oder malt der Künstler auf eine Glas-, Acryl- oder Metallplatte. Solange die Farbe noch feucht ist, wird sie mit Hilfe einer Presse oder Handabreibung auf ein Platt Papier gedruckt. Es entsteht nur ein einziger Abzug, da für einen zweiten zu wenig Farbmaterial auf der Platte zurück bleibt.